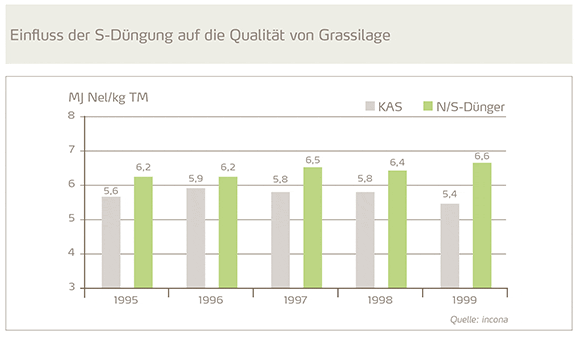Rund ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ist Dauergrünland, ungefähr 4,7 Millionen Hektar. Die Düngung des Grünlands hängt ab von: Nutzungsintensität, Nutzungsart (Wiese, Mähweide, Weide), Standortverhältnissen, Pflanzenzusammensetzung und Nährstoffnachlieferung (beispielsweise aus Beweidung). Mit der Grünland Düngung soll eine hohe Grundfutterqualität und dadurch eine hohe Grundfutterleistung erzielt werden.
Was versteht man unter Grünland?
Als Grünland werden die landwirtschaftlichen Flächen bezeichnet, auf denen Gras oder krautige Pflanzen in einer Dauerkultur wachsen, also nicht regelmäßig umgebrochen werden. Diese Grünlandflächen werden entweder beweidet oder in Schnittnutzung wird das Erntegut abgefahren.
Was ist der Unterschied zwischen Ackerland und Grünland?
Auf Grünlandflächen wachsen die Gras- oder Kleearten in Dauerkultur. Es findet kein Umbruch statt. Auf Ackerland findet ein Fruchtwechsel statt und der Boden wird meist wendend bearbeitet.
Wie wird Grünland genutzt?
Unter Grünland ist das klassische Dauergrünland zu verstehen. Hier findet kein Umbruch statt. Es kann zur reinen Schnittnutzung, als reine Weide oder wechselnd (Schnitt- und Weidenutzung) bewirtschaftet werden. Ackergras wird zeitlich begrenzt auf bestehenden Ackerflächen angebaut. Ackergras wird daher auch als Wechselgrünland bezeichnet.
Ackergras
Ackergras wird als Zwischenfrucht zur Auflockerung der Fruchtfolge eingesetzt. Das Erntegut wird vorwiegend für die Milchviehfütterung genutzt.
Pferdeweiden
Pferdeweiden sind Dauergrünland, das für eine unterschiedlich intensive Bewirtschaftung mit Pferden genutzt wird. Die Weiden benötigen eine bedarfsgerechte Düngung, die Tier und Bestand gleichermaßen zugutekommt.
Was sollte bei der Grünlandpflege beachtet werden?
Die richtige Grünlandpflege ist gerade für beweidete Flächen wichtig. Im Frühjahr sind Schleppen, Walzen und gegebenenfalls eine Nachsaat lückiger Bereiche auf dem Grünland wichtig. Während der Beweidung sollten auch überständige Pflanzen (Geilstellen) möglichst gemulcht werden.
Was ist bei der Düngung von Grünland zu beachten?
Bei der Grünlanddüngung muss darauf geachtet werden, dass die Düngestrategie der Nutzungsrichtung angepasst wird.
Hierbei sind z.B. folgende Fragen relevant:
- Soll das Grünland beweidet werden oder ausschließlich der Schnittnutzung dienen?
- Soll der Aufwuchs als Silage für Hochleistungsmilchvieh genutzt werden oder ist Pferdeheu geplant?
- Wie viele Schnitte sind geplant?
Steht der Düngebedarf für das Grünland anhand der Nutzungsrichtung fest, kann die Düngung gezielt geplant werden.
Stickstoff Düngung von Grünland
Die Stickstoff-Düngung im Grünland hängt von der Verwertungsrichtung ab. Daran wird Zeitpunkt und Höhe der einzelnen Gaben ausgerichtet.
Schwefeldüngung von Grünland
Bei intensiver Schnittnutzung und hoher Stickstoff-Düngung sollten 20 bis 40 Kilogramm Schwefel pro Hektar ergänzt werden. Das unterstützt auch die Stickstoff-Ausnutzung.
Schwefelmangel äußert sich folgendermaßen:
- reduziert die Stickstoff- Ausnutzung und damit den Ertrag
- führt zu höheren Nitratgehalten im Aufwuchs
- reduziert die wertvollen schwefelhaltigen Aminosäuren wie zum Beispiel Methionin und Cystein
- vermindert die Lagerfähigkeit der Silage
Schwefel verbessert den Ertrag, die Futterqualität und die Lagerstabilität (der Grassilage) beim Grünland. Circa 20 bis 40 Kilogramm Schwefel pro Hektar sind im Grünland ausreichend, wobei das Stickstoff-Schwefel-Verhältnis kleiner als 12/1 optimal ist. Am besten wird die Schwefelgabe auf eine Düngung zum ersten und zweiten Schnitt aufgeteilt.
Grünlanddüngung mit Phosphor, Kalium und Magnesium
Die Grunddüngung sollte nach Bodenuntersuchung erfolgen. Hier ist es wichtig, Kalium-Luxuskonsum zu vermeiden. Daher sollten maximale Einzelgaben von 150 Kilogramm K2O pro Hektar und Gabe ausgebracht werden. Kalium steht in Konkurrenz mit Natrium und Magnesium, hohe Kalium-Verfügbarkeiten senken die Aufnahme von Magnesium, Calcium und Natrium: Optimal sind Verhältnisse von Kalium zu Natrium von 10 bis 20 zu eins und K2O zu Magnesium von 1,5 bis 2 zu eins.
Magnesium-Mangel ist häufig auf leichten und sauren Böden mit hohen Niederschlägen zu finden.
Der Magnesium-Gehalt im Futter sollte bei 0,18 bis 0,24 Prozent in der Trockensubstanz liegen.
Die Phosphat-Versorgung des Grünlands beeinflusst vor allem den Anteil wertvoller Leguminosen und Kräuter. Die Phosphatform hat eine etwas geringere Bedeutung als im Ackerbau, da die Böden beim Grünland häufig eine höhere biologische Aktivität im Boden aufweisen.
Beispiele zum Düngebedarf* von Grünlandbeständen mit unterschiedlicher botanischer Zusammensetzung und Nutzung
(nach „Gelben Heft, 2007“; zahlen auf 5 gerundet)
Wiesen:
Nutzung: Weidelgrasreiche Wiese, 5 Nutzungen, vorwiegend als Silage, optimaler Bestand
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 290 |
| P2O5 | 110 |
| K2O | 375 |
| MgO | 50 |
Nutzung: Kräuterreiche Wiese, 4 Nutzungen, vorwiegend als Silage, optimaler Bestand
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 205 |
| P2O5 | 90 |
| K2O | 270 |
| MgO | 65 |
Nutzung: Fuchsschwanzwiese, 4 (3-4) Nutzungen, vorwiegend als Silage, optimaler Bestand
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 155 |
| P2O5 | 65 |
| K2O | 205 |
| MgO | 30 |
Nutzung: Obergrasreiche Wiese, 3 Nutzungen, vorwiegend als Heu, optimaler Bestand
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 120 |
| P2O5 | 50 |
| K2O | 180 |
| MgO | 30 |
Mähweiden und Weiden:
Nutzung: Kräuterreiche Mähweiden, 4 Nutzungen, 50% Schnitt und Weide, optimaler Bestand
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 145 |
| P2O5 | 55 |
| K2O | 160 |
| MgO | 40 |
Nutzung: Weidegrasreiche intensive Standweide, Standort entsprechend 4 Schnittnutzungen
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 130 |
| P2O5 | 49 |
| K2O | 125 |
| MgO | 20 |
Nutzung: Extensive Jungvieh- oder Pferdeweide
Nährstoffgehalt: kg/dt Frischmasse
| N | 30 |
| P2O5 | 15 |
| K2O | 55 |
| MgO | 10 |
Organische Grünlanddüngung
Es sollte möglichst flüssige Gülle für die Grünland Düngung eingesetzt werden:
- läuft besser an Pflanzen ab
- dringt besser in den Boden ein
- geringere Ammoniakverluste
Nach der neuen DüVo und dem Wegfall der Derogationsregelung sind nur noch 170 kg N pro ha und Jahr aus organischen Düngern zulässig. Die organische Düngung sollte möglichst direkt nach der Nutzung erfolgen.
Die Grundnährstoffe sind voll bilanzierbar, da Phosphor und Kali zum größten Teil anorganisch gebunden sind.
Die Effizienz der Düngemaßnahmen wird erhöht durch:
- bodennahe/verlustarme Ausbringung der Gülle
- verbesserte Qualitäten der Grünlandnarben (Grünlandpflege, Weidemanagement)
- Einsatz verlustarmer und effizienter mineralischer Stickstoff-Dünger
Je intensiver die Nutzung, umso hochwertiger das Grundfutter! Mit zunehmender Schnitthäufigkeit oder Weidenutzung steigt parallel zur Düngung auch der Futterwert, wodurch die Energie- und Rohproteingehalte steigen, was wiederum eine Zunahme der Verdaulichkeit bewirkt.
Grünland Natrium Düngung
Die Düngeempfehlung liegt bei circa 30 Kilogramm Natrium pro Hektar. Natrium ist in erster Linie für die Schmackhaftigkeit des Futters verantwortlich, sorgt also für eine höhere Futteraufnahme.
Die Düngung des Grünlands mit Natrium hat keine ertragssteigernde Wirkung. Es ist keine Vorratsdüngung möglich.
Mikronährstoffe im Grünland
Der Gehalt an Mikronährstoffen ist häufig in Kräutern und Leguminosen höher als in Gräsern.
Mit fortschreitender Vegetationszeit nehmen die Gehalte häufig zu (ansteigender Leguminosen- und Kräuteranteil). Die Blätter sind nährstoffreicher als die Stängel. Außerdem ist in jungen Pflanzen mehr enthalten als in älteren Pflanzen.
Mangan: Ein Mangel tritt häufig auf Niedermoor-Standorten auf, bei erhöhten pH-Werten, Trockenheit und entwässerten Böden. Das führt zu einer verringerten Ausdauer wertvoller Bestandsbildner, einer schlechten Bestockung wertvoller Obergräser und beeinträchtigt die Fruchtbarkeit beim Tier.
Kupfer: Häufig tritt Kupfermangel auf Niedermoor-Standorten und bei erhöhten pH-Werten auf. Der Mangel verursacht eine schlechte Stickstoff-Verwertung sowie eine verringerte Ausdauer wertvoller Bestandsbildner.
Bei Verdacht auf Mikronährstoffmangel sollten Sie möglichst eine Bodenuntersuchung durchführen.
Selen: Selen ist kein Nährelement für die Pflanzen im Grünland, sondern ist ausschließlich für die Versorgung von Mensch und Tier notwendig. Eine Düngung mit Selen kann die Se-Versorgung und -Ausnutzung bei Mensch und Tier verbessern.
Bsp. bei Selenmangel für die Selendüngung: 5 – 10 g Se/ha/Jahr (Mengen von über 5 mg/kg TM wirken toxisch)
Boden pH-Wert für Grünland
Optimale pH-Werte für die Böden im Grünland:
- Sandboden: 5,0
- lehmige Sande: 5,5 – 6
- Lehm: 6,0
Je besser der pH-Wert des Bodens (in Relation zur Bodenbeschaffenheit), desto besser ist die Verfügbarkeit der Nährstoffe. Mit einer ausgewogenen Kalkversorgung, möglichst unter Einsatz kohlensaurer oder silikatischer Kalke, kann der pH-Wert des Bodens beeinflusst werden.
Zusätzliche Informationen zum Thema Grünlandkalkung können Sie hier nachlesen: